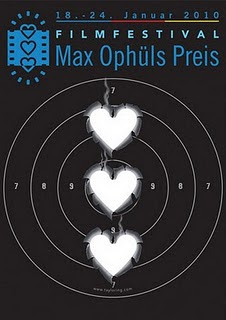Max Ophüls Preis 2010 – Die Gewinner
Am Samstagabend, dem 23. Januar, wurden sie verliehen, die Auszeichnungen des Max Ophüls Preises 2010, und bevor Screenshot sich weiteren Filmen des Festivals im Detail widmet, hier die Übersicht und ein paar Kommentare dazu.
Erstens: Es war ein wirklich rundes Festival. Die Coaching- und Castingbranchentage wirkten als Wuchtblock fast wie eine Gegenveranstaltung, und nebenher schien es mit einer Podiumsdiskussion und dem obligatorischen HD-Showreel auch kaum etwas als Alternative zu geben. Die neue Presselounge im Cinestar, wo die meisten Filme zu sehen waren, bot eine kostbare Rückzugs-, Sitz-, Sichtungsmöglichkeit samt WLAN-Zugang. Wichtiger aber noch: Die Auswahl des Lang- wie Kurzfilmwettbewerbs machte einem die Prämierungsvoraussage schwer – einfach weil soviel Qualität zu bewundern war und in der Gänze den 31. „MOP“ von der Jubiläumsausgabe im Jahr 2009 merklich abhob.
Zweitens: Die Preisverleihung in der fein hergerichteten aber unbezwingbar unsympathischen Saarbrücker Congresshalle war ein merkwürdiger Höhepunkt, zumindest was die Ver- und Zerteilung der Auszeichnungen betraf.
Dass die – haha – religiös motivierte Interfilm-Jury ihren ganz eigenen Film überraschte freilich nicht. Sie erkoren Olaf Saumers SUICIDE CLUB. Dessen Mängel wurden hier bereits bemäkelt, doch den Interfilmpreis hat er inhaltlich, in seiner Thematik zu Leben und Tod sowie was beides auf welche Weise wert macht, verdient.
Zum besten Kurzfilm wurde der schweizerische SCHONZEIT von Irene Ledermann gekürt. Er erkundet mit dichter Kamera und engem Schärfebereich einfühlsam die Trauer und das Zurechtkommen eines kleinen Jungen nach dem Tod der Mutter, sein Erleben der innerlichen Flucht des Vaters und die Mühe des (etwas) älteren Bruders, alle(s) beisammen zu halten. Verträumt und bodenständig zugleich ist SCHONZEIT; er – so die Jury – „schwebt über die Leinwand, funktioniert wie ein Traum, ganz über Emotion, über Atmosphäre und Stimmung. Er setzt seine filmischen Mittel gekonnt ein und schafft es, ohne viel Worte zu erzählen, ohne zu kommentieren und zu erklären […]“. Wobei dem deftigen kehligen Schwyzerdütsch dabei nochmal eine ganz eigene Bedeutung zukommt. Allerdings: Auch vielen anderen Kurzfilmen hätte in Saarbrücken die Auszeichnung zugestanden. Sich in der Entscheidung hier besonders auf die Form zu konzentrieren, hatte jedoch etwas Weises.

Geradezu ein Overkill an Salomonik bot hingegen die Dokumentarfilmpreisjury. Sie zeichnete nicht nur einen, sondern zwei Filme aus, NIRGENDWO.KOSOVO von Silvana Santamaria sowie Katharina von Schroeders MY GLOBE IS BROKEN IN RWANDA, und als ob das nicht genug wäre, wurde der großartige HOFFENHEIM – DAS LEBEN IST KEIN HEIMSPIEL über die Entwicklung des „Markenprojekts“ TSG Hoffenheim auch noch extra lobend erwähnt. Mögen alle Filme das und mehr verdient haben, angesichts von ohnehin nur zehn Dokufilmen im Wettbewerb wirkt solches Lavieren so ungeschickt wie die Jury-Begründung, in der es wie in einem Schulaufsatz heißt: „Wir haben ein paar tolle Filme gesehen, drei Dokumentarfilme über Wirklichkeiten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können und zwischen denen wir uns entscheiden mussten.“ Wie, nur drei Filme haben Lars-Peter Barthel, Claudia Gleisner und Peter Thiltges gesehen? Aber in HOFFENHEIM geht es ja auch, ihrem Begründungstext gemäß, leicht posierlich um den „Aufstieg einer Fußballmannschaft (!)“.
Lauter Zusatz- und Sondertrallala auch beim Hauptpreis oder der Schauspielerei: Woher zum Geier kam da die zweigeteilte Verleihförderung und ein Sonderpreis für einen Nicht-mehr-Nachwuchsdarsteller? Natürlich gab es sowas früher schon, der Langfilmförderpreis wurde gar regelmäßig bis 2006 verliehen, der Jurysonderpreis immer mal wieder - zuletzt 2002 für Jörg Kalt. Nur kam alle Sonderwursterei 2010 so massenhaft und zugleich nebenbei daher, dass bei den vielen nicht vorhandenen Trophäen und der Verwirrung auf der Bühne nicht nur die Preise entwertet schienen, sondern auch das Festival selbst von der um sich greifenden Gewitztheit seiner Juroren überrumpelt wirkte. Zehn Euro mehr in der Tasche und feineres Schuhwerk an den Füßen und Ihr Screenshot-Autor wäre auch auf die Bühne und hätte schnell irgendwas oder irgendwen ausgezeichnet. Oder besser gesagt: Auch nochmal einen (oder beide) der Spielfilme, die ohnehin die großen Abräumer waren, auch bei den Ausnahmepreisen.
Sieht man mal von sowas wie dem Förderpreis der DEFA-Stiftung (Jessica Hausners phänomenaler LOURDES – hei, wäre der mal im Wettbewerb gelaufen!), dem klug begründeten Filmmusikpreis für ACADEMIA PLATONOS – PLATO’S ACADEMY von Filippos Tsitos oder den Preis des saarländischen Ministerpräsidenten für Philip Kochs bedrückendes Jugendknastdrama PICCO, dann bekamen Maximilian Erlenweins SCHWERKRAFT und BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG von Oliver Kienle gefühlsmäßig irgendwie – „alles“.
Was ja nicht stimmte; die nobelbleiche herrlich fragile und gleichzeitig grimmige Nora von Waldstätten (u.a. TANGERINE, PARKOUR und demnächst in Olivier Assayas CARLOS THE JACKAL) wurde ja nicht als beste Nachwuchsdarstellerin nur wegen ihrer (durchaus dünnen) Rolle in SCHWERKRAFT prämiert. (Wie der nun ebenfalls beim MOP 2010 gekürte beste Nachwuchsdarsteller Sebastian Urzendowsky –
PAUL IS DEAD, PINGPONG, DIE FÄLSCHER u.V!.m. – war man nicht überrascht, dass sie die Ehrung erhielt weil man es ihr nicht zugestehen wollte, sondern weil man stets schon bei sich dachte, sie hätte die Ehrung schon längst erhalten.)

Alles in allem aber bekamen (so oder so):
SCHWERKRAFT:
- den Max Ophüls Preis 2010
- den Drehbuchpreis (für Maximilian Erlenwein)
- (Nora von Waldstätten): den Preis für die beste Nachwuchsdarstellerin
- (Fabian Hindrichs für seine Rolle in SCHWERKRAFT): Sonderpreis
und
BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG:
- den Preis der Schüler-Jury
- den Publikumspreis
- eine der beiden Verleihförderungen (die andere ging an Andreas Arnstedts DIE ENTBEHRLICHEN)
BIS AUFS BLUT, der „Zielgruppe“ wie „Fußvolk“ so prächtig gefiel, ist auch wirklich ein mitreißendes, fast brachiales Stück Kino. Dass bei einer der Vorführung die Bässe des Soundtracks die Lautsprecher im Saal beinahe ruinierten, wirkt weniger wie ein Vorführfehler als eine Art freud’scher Technik-Versprecher. Keine Frage, BIS AUFS BLUT hat Wumms, aber auch Herz. Zunächst kann man noch skeptisch sein, bei all der Coolness und Rasanz, angesichts von Pose und Gestus: Als Bub wird Tommy an der Bushaltestelle von älteren Kids dumm angemacht, worauf der gleichaltrige türke Sule rabiat eingreift – der Beginn einer langen, engen Freundschaft, dessen Entwicklung der Film im lauten Eiltempo zum Vorspann zeigt; wie beide in der Rapper-Szene aufwachsen, mit Gras-Deals Geld machen, ein dickes Auto fahren, ein lässiges Leben führen, einen Dreck auf Berufsschule (Sule) und Gymnasium (Tommy) geben; wie sich Tommy in Sina verliebt; er und Sule von einem Tuning-Laden träumen – und sich das Blatt wendet: Zivilbullen, Hausdurchsuchung. Tommy wandert in den Jugendknast, wo ihm das Leben zur Hölle gemacht wird.

Nach sechs Monaten ist er wieder draußen. „Opfer“ haben sie ihm auf den Handrücken tätowiert, und Tommy will nix mehr mit „der Scheiße“ zu tun haben, keine Drogen mehr, Sina zurückbekommen, Abschluss machen. Aber Sule ist und bleibt seine bester Freund, überhaupt das Milieu sein Zuhause, und hier kriegt der Film den Zuschauer, frisst einen mit Haut und Haaren. Ganz schnell vergessen ist aller Argwohn, entpuppen sich die Figuren, ihr Tun, Sein und Auftreten nicht als nervtötende Konstruktion, um Sozialdrama zu spielen, als hohl und selbstgefällig, um zu provozieren oder sich in seiner Wild- und Coolheit simpel selbst zu feiern. BIS AUFS BLUT erinnert an 13 SEMESTER, nicht nur, weil hier Würzburg zur Gangsta- und Rapper-Kleinstadt wird wie dort Darmstadt als perfekte Kulisse fürs kleine Studiumsuniversum; weil sich Großes auch im Kleinen besser betrachten lässt, vor allem die antreibende Verzweiflung und Verunsicherung dahinter. Auch BIS AUFS BLUT hantiert mit einigen Klischees und Typen, zeigt, dass und wie diese eben doch dem Leben entspringen – und vor allem: BIS AUFS BLUT ist ungeheuer witzig.

Regisseur Oliver Kienle lässt einen ebenso über die Protagoniste wie mit ihnen lachen, an ihren großen, bisweilen albernen Träumen und Selbstbehauptungen teilhaben und an dem dicken Mist, den sie bauen und angesichts dessen man trotzdem nicht anders kann, als sie zu mögen oder zumindest zu verstehen. Man schließt sie in Herz, alle. Sogar die Nebenfiguren, von denen keine einzige verkauft wird, ist rund und zugleich mit den nötigen Ecken versehen, sogar noch die Funktionalsten unter ihnen; Sules frühreife „Freundin“, die Zivilpolizistin oder der Lehrer, der dem Kindskopf Tommy am liebsten gleichzeitig Vernunft einbläuen und ihn umarmen würde, so aber einfach mit ihm Zigaretten raucht. Kienle schließt uns den Mikrokosmos von innen auf und plötzlich ist man in dieser vielfach abstoßenden Poserwelt aus „Ficken“-, „Fucker“- und „Fotzen“-Asozialität und -Großspurigkeit, in der es doch komplexer zugeht und heimeliger sein kann als im Vorstadthaus, wo die Mutter Therapeutin ist oder in der Landvilla, wo Tochter Weinprinzessin den rüden Straßentürken mitbringt, um – noch rüder – Papas Aufmerksamkeit zu bekommen. Mit ein Grund für all das Gelingen sind natürlich auch die beiden phantastischen Darsteller: Burak Yigit als Sule und Jacob Matschenz als Tommy, die jeder für sich die ganze große, darstellerisch doppelt schwierige Bandbreite von Hilflosigkeit und Humor, Brutalität, Angst und linkischer Liebe, von Aufrichtigkeit, Rollenspiel und Kontrollverlust meistert, die vielen Einzelaspekte ihrere Jungs so sicher und genau zusammenschnüren, dass man sich an ihnen kaum sattsehen mag.
Doch Kienle belässt es nicht bei dieser Rundreise. Er bietet uns unverschämt leichthändig und große emotionale Story um Freundschaft und Verrat, die ins Herz trifft. Tommy ist nämlich verpfiffen worden, will, immer mal wieder, herausbekommen von wem. Als Zuschauer, gewohnt, auf das größte dramatische Potential zu achten, denkt man sich schon, von wem. Aber auch, wenn es genauso ist, kommt es zugleich und am Ende ganz anders, in Sachen Stimmung, im Stil, in der Bedeutung. So lehrt einem BIS AUF BLUT in seiner bravourös ungestümen, lebensprallen Art, angesichts der man einige formale Spirenzchen wie das „Filmstreifenspulen“ nicht nur verzeiht, sondern gar begrüßt, einiges über Vernunft, Aufrichtigkeit und Loyalität, auf eine Art, wie das nur ganz sensibles und besonders nassforsches Kino kann. Beides bietet der laute und geschickte, rohe und elegante Starkstromfilm BIS AUFS BLUT, der es hoffentlich wirklich auf die Leinwand schaft.
Auch SCHWERKRAFT ist ein gute Film, dem der Max Ophüls Preis durchaus zusteht. Auch und gerade Fabian Hinrichs Spiel ist bemerkenswert. Doch: Drehbuchpreis? Na schön. Aber mit solch einer Begründung?
SCHWERKRAFT, das ist die Geschichte von Frederick (Hinrichs), der Kreditberater in einer Bank ist, jeden Morgen einen Parkplatz sucht und ihn sich wegschnappen lässt, der heimlich seine Ex-Freundin Nadine (v. WALDSTÄTTEN) beobachtet – und dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als sich vor seinen Augen ein Kunde aus Finanznöten erschießt. Das bringt den ordentlichen Mann natürlich aus der Bahn, wenn auch zunächst nur innerlich, und überhaupt: Ob da je was im Lot war, bestreitet der Film schließlich selbst. Als müsse er sich seine Lebendigkeit beweisen, lässt Frederick zunächst experimentell behutsam den Mr. Hyde raus, will eine CD im Laden klauen, einfach so, wird aber von einem Angestellten gewarnt: Vince (mit eingefrorenem Gesicht: Jürgen Vogel), Angestellter des Elektromarkts und Ex-Knacki war Fredericks alter Bandkollege, beide haben sich aus den Augen verloren. Und beide tun sie sich zusammen: Nachdem Frederick bei seinem Chef einsteigen will, dabei seine Kreditkarte verliert und auf Vincens Handwerkskunst angewiesen ist, starten sie eine Zweierkarriere und unterkühlte Freundschaft, in der Frederick Wissen und Daten seiner Kundschaft zur Handwerkskunst und den Unterweltkontakten von Vince beisteuert. Der Ex-Knacki bekommt seine erträumte Kneipe, Fredericks soziopathische Lebensenergie genug, um im Alltag aufzumucken und es mit Nadine neu zu versuchen. Doch das alles kann natürlich nicht gut gehen; Vince hat noch eine alte Rechnung zu begleichen und Frederick verliert immer mehr den Halt…

Wie in FIGHT CLUB dient in SCHWERKRAFT körperliche Gewalt und Normverletzung zur Selbstvergewisserung, Selbstverwirklichung, wird Verkrustetes aufgesprengt – und tatsächlich kauft man das Hinrichs Frederick sofort ab, das Überschreiten und den Wechsel von Spießer und Depp zum Brutalo und zugleich Verlorenen – die eine wie die andere Seite ist bereits angelegt oder wird ihm nicht ausgetrieben. Lakonisch und zugleich leicht traumwandlerisch ist die Inszenierung, ist die Gesetztheit der Worte und deren Fehlen, wenn es darum geht, was wirklich zählt und ist. Tatsächlich ist die Story geschickt, immer mehr rutscht Frederick hinein und zugleich hinaus, und dafür braucht es keinen eingebildeten Freund: Jürgen Vogels Vince ist kein jovialer Tyler Durden, im Gegenteil, er bleibt immer ein wenig unnahbar, selbst ein Verwundeter, und der Film birgt bei aller Skurrilität seine Tragik in Stimmung und Rhythmus immer schon in sich. Das ist – wie die MOP-Jury bemerkt – durchaus ganz großes Kino. Die letzten wenigen Einstellungen überraschen und brauchen dazu nur ein Lächeln, so dass man gerne drangibt, wie der Film schlussendlich etwas auseinanderfällt (was im Übrigen bei vielen Filmen des MOP-Langfilmwettbewerbes zu bemerken war).
Und natürlich ist da diese Szene, eine inhaltliche und bildliche Idee, wie man sie hierzulande kaum erwartet hätte: Vince willigt ein, Frederick zum Azubi zu nehmen; sie sitzen in einem Auto; in einer Gasse stehen einige kräftige Skinheads herum. Um gleich anzufangen mit der Lehre, ordnet Vince an, Frederick solle sich den Größten rauspicken. Vince reicht ihm einen Baseballschläger. Frederick überlegt kurz, nickt, steigt aus – und verhaut mit Ski-Maske und im edlen dunklen Bankeranzug samt Mantel ohne zu zögern die Kerle, die flugs reißausnehmen.
So bietet SCHWERKRAFT tatsächlich Momente, die, so die MOP-Jury, an die Filme der Coen-Brüder erinnern, schräg und schwarz und irgendwie unauflöslich, die unterhalten und zugleich einen leicht irritiert zurücklassen.

Auch die Drehbuchjury (Daniel Blum, Anette Kührmeyer, Jan Henrik Stahlberg) hat also durchaus ein bisschen Recht, doch zugleich hat dieser wirklich vorzügliche Film einige Mängel, die sich nicht mit dem angeführten geschickten Unterlaufen von „konventionellen“ Genrekino-Erwartungen wegloben lassen, z.B. wenn Vince Freundin, die zentral wird für seine Backstory-Wunde, irgendwie plötzlich da ist; wenn für das dramatische Ende schnell noch erklärend die Ex-Arbeitskollegin von der Arbeit als Tippgeber eingeblendet wird, hinsichtlich der sich SCHWERKRAFT dramaturgisch auch nicht entscheiden will.
Genreerwartungen unterlaufen kann zwischen NO COUNTRY FOR OLD MAN und DER KNOCHENMANN (um mal zwei schwere Geschütze aufzufahren) manchmal eben auch bedeuten, unsauber zu erzählen. Hier bedeutet es vor allem, zwischen Erfüllen und Verweigern sehr oft, aber nicht immer die richtige Balance und vor allem: die richtige Konsequenz zu finden. Das Ausbrechen aus sterilen Leben als Story muss sich zudem gerade erzählerisch – siehe FIGHT CLUB, siehe AMERICAN BEAUTY, auch in Deutschland: siehe Ulrich Köhlers MONTAG KOMMEN DIE FENSTER – an ganz anderen Standards der Originalität (und damit auch der „Genrehaftigkeit“) messen lassen.
Mehr aber ist das Lob der Jury selbst überzogen. „Restlos“ gelungen sei der Film; die Entscheidung, so verkündet Stahlberg auf der Bühne, sei sehr leicht gefallen. Was den Film ebenso ungerechtfertigt überhöht wie er alle anderen – z.B. MEIN LEBEN IM OFF – herabsetzt. Auch wenn Stahlberg Erlenwein Kontra gab, weil dieser in seiner Dankesrede annahm, die Jury habe nur den Film gesehen und nicht das Skript gelesen: SCHWERKRAFT, der seine drehbuchjurygelobte „enorme Leichtigkeit“ zum großen Teil den Schauspielern und der Inszenierung verdankt, wurde wohl eher als Ganzes ausgezeichnet als sein Skript allein.
Übrigens, der letzte Film, der dem Max Ophüls Preis und den Drehbuchpreis erhielt, war 2006 Benjamin Heisenbergs SCHLÄFER. Auf solche eine Qualität wartet man heute noch und wieder. Denn im Guten wie im Schlechten war der 31. Max Ophüls Preis kein Festival der Drehbücher.

Die Preisträger im Überblick:
MAX OPHÜLS PREIS 2010:
SCHWERKRAFT, Regie: Maximilian Erlenwein
Verleihförderung von je 9.000 Euro geht zu gleichen Teilen an:
BIS AUF´S BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG, Regie: Oliver Kienle
DIE ENTBEHRLICHEN, Regie: Andreas Arnstedt
Preis des saarländischen Ministerpräsidenten:
PICCO, Regie: Philip Koch
Der Preis für den Besten Kurzfilm:
SCHONZEIT, Regie: Irene Ledermann
Der SR/ZDF-Drehbuchpreis:
SCHWERKRAFT, Regie: Maximilian Erlenwein
Der Förderpreis der DEFA-Stiftung:
LOURDES, Regie: Jessica Hausner
Der Preis für den Besten Dokumentarfilm geht zu gleichen Teilen an:
NIRGENDWO.KOSOVO, Regie: Silvana Santamaria
MY GLOBE IS BROKEN IN RWANDA, Regie: Katharina von Schroeder
Der Preis für den Mittellangen Film: RAMMBOCK, Regie: Marvin Kren ((= Gewinner des letztjährigen Kurzfilmpreises für SCHAUTAG)
Sonderpreis für FABIAN HINRICHS für seine Rolle in „Schwerkraft”
Der Preis für die Beste Nachwuchsdarstellerin: NORA VON WALDSTÄTTEN
Der Preis für den Besten Nachwuchsdarsteller: SEBASTIAN URZENDOWSKY
Der Filmmusikpreis: ACADEMIA PLATONOS – PLATO’S ACADEMY, Regie: Filippos Tsitos
Der Publikumspreis: BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG, Regie: Oliver Kienle
Der Preis der Schülerjury: BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG, Regie: Oliver Kienle
Der Interfilmpreis: SUICIDE CLUB, Regie: Olaf Saumer
Erstens: Es war ein wirklich rundes Festival. Die Coaching- und Castingbranchentage wirkten als Wuchtblock fast wie eine Gegenveranstaltung, und nebenher schien es mit einer Podiumsdiskussion und dem obligatorischen HD-Showreel auch kaum etwas als Alternative zu geben. Die neue Presselounge im Cinestar, wo die meisten Filme zu sehen waren, bot eine kostbare Rückzugs-, Sitz-, Sichtungsmöglichkeit samt WLAN-Zugang. Wichtiger aber noch: Die Auswahl des Lang- wie Kurzfilmwettbewerbs machte einem die Prämierungsvoraussage schwer – einfach weil soviel Qualität zu bewundern war und in der Gänze den 31. „MOP“ von der Jubiläumsausgabe im Jahr 2009 merklich abhob.
Zweitens: Die Preisverleihung in der fein hergerichteten aber unbezwingbar unsympathischen Saarbrücker Congresshalle war ein merkwürdiger Höhepunkt, zumindest was die Ver- und Zerteilung der Auszeichnungen betraf.
Dass die – haha – religiös motivierte Interfilm-Jury ihren ganz eigenen Film überraschte freilich nicht. Sie erkoren Olaf Saumers SUICIDE CLUB. Dessen Mängel wurden hier bereits bemäkelt, doch den Interfilmpreis hat er inhaltlich, in seiner Thematik zu Leben und Tod sowie was beides auf welche Weise wert macht, verdient.
Zum besten Kurzfilm wurde der schweizerische SCHONZEIT von Irene Ledermann gekürt. Er erkundet mit dichter Kamera und engem Schärfebereich einfühlsam die Trauer und das Zurechtkommen eines kleinen Jungen nach dem Tod der Mutter, sein Erleben der innerlichen Flucht des Vaters und die Mühe des (etwas) älteren Bruders, alle(s) beisammen zu halten. Verträumt und bodenständig zugleich ist SCHONZEIT; er – so die Jury – „schwebt über die Leinwand, funktioniert wie ein Traum, ganz über Emotion, über Atmosphäre und Stimmung. Er setzt seine filmischen Mittel gekonnt ein und schafft es, ohne viel Worte zu erzählen, ohne zu kommentieren und zu erklären […]“. Wobei dem deftigen kehligen Schwyzerdütsch dabei nochmal eine ganz eigene Bedeutung zukommt. Allerdings: Auch vielen anderen Kurzfilmen hätte in Saarbrücken die Auszeichnung zugestanden. Sich in der Entscheidung hier besonders auf die Form zu konzentrieren, hatte jedoch etwas Weises.

Geradezu ein Overkill an Salomonik bot hingegen die Dokumentarfilmpreisjury. Sie zeichnete nicht nur einen, sondern zwei Filme aus, NIRGENDWO.KOSOVO von Silvana Santamaria sowie Katharina von Schroeders MY GLOBE IS BROKEN IN RWANDA, und als ob das nicht genug wäre, wurde der großartige HOFFENHEIM – DAS LEBEN IST KEIN HEIMSPIEL über die Entwicklung des „Markenprojekts“ TSG Hoffenheim auch noch extra lobend erwähnt. Mögen alle Filme das und mehr verdient haben, angesichts von ohnehin nur zehn Dokufilmen im Wettbewerb wirkt solches Lavieren so ungeschickt wie die Jury-Begründung, in der es wie in einem Schulaufsatz heißt: „Wir haben ein paar tolle Filme gesehen, drei Dokumentarfilme über Wirklichkeiten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können und zwischen denen wir uns entscheiden mussten.“ Wie, nur drei Filme haben Lars-Peter Barthel, Claudia Gleisner und Peter Thiltges gesehen? Aber in HOFFENHEIM geht es ja auch, ihrem Begründungstext gemäß, leicht posierlich um den „Aufstieg einer Fußballmannschaft (!)“.
Lauter Zusatz- und Sondertrallala auch beim Hauptpreis oder der Schauspielerei: Woher zum Geier kam da die zweigeteilte Verleihförderung und ein Sonderpreis für einen Nicht-mehr-Nachwuchsdarsteller? Natürlich gab es sowas früher schon, der Langfilmförderpreis wurde gar regelmäßig bis 2006 verliehen, der Jurysonderpreis immer mal wieder - zuletzt 2002 für Jörg Kalt. Nur kam alle Sonderwursterei 2010 so massenhaft und zugleich nebenbei daher, dass bei den vielen nicht vorhandenen Trophäen und der Verwirrung auf der Bühne nicht nur die Preise entwertet schienen, sondern auch das Festival selbst von der um sich greifenden Gewitztheit seiner Juroren überrumpelt wirkte. Zehn Euro mehr in der Tasche und feineres Schuhwerk an den Füßen und Ihr Screenshot-Autor wäre auch auf die Bühne und hätte schnell irgendwas oder irgendwen ausgezeichnet. Oder besser gesagt: Auch nochmal einen (oder beide) der Spielfilme, die ohnehin die großen Abräumer waren, auch bei den Ausnahmepreisen.
Sieht man mal von sowas wie dem Förderpreis der DEFA-Stiftung (Jessica Hausners phänomenaler LOURDES – hei, wäre der mal im Wettbewerb gelaufen!), dem klug begründeten Filmmusikpreis für ACADEMIA PLATONOS – PLATO’S ACADEMY von Filippos Tsitos oder den Preis des saarländischen Ministerpräsidenten für Philip Kochs bedrückendes Jugendknastdrama PICCO, dann bekamen Maximilian Erlenweins SCHWERKRAFT und BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG von Oliver Kienle gefühlsmäßig irgendwie – „alles“.
Was ja nicht stimmte; die nobelbleiche herrlich fragile und gleichzeitig grimmige Nora von Waldstätten (u.a. TANGERINE, PARKOUR und demnächst in Olivier Assayas CARLOS THE JACKAL) wurde ja nicht als beste Nachwuchsdarstellerin nur wegen ihrer (durchaus dünnen) Rolle in SCHWERKRAFT prämiert. (Wie der nun ebenfalls beim MOP 2010 gekürte beste Nachwuchsdarsteller Sebastian Urzendowsky –
PAUL IS DEAD, PINGPONG, DIE FÄLSCHER u.V!.m. – war man nicht überrascht, dass sie die Ehrung erhielt weil man es ihr nicht zugestehen wollte, sondern weil man stets schon bei sich dachte, sie hätte die Ehrung schon längst erhalten.)

Alles in allem aber bekamen (so oder so):
SCHWERKRAFT:
- den Max Ophüls Preis 2010
- den Drehbuchpreis (für Maximilian Erlenwein)
- (Nora von Waldstätten): den Preis für die beste Nachwuchsdarstellerin
- (Fabian Hindrichs für seine Rolle in SCHWERKRAFT): Sonderpreis
und
BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG:
- den Preis der Schüler-Jury
- den Publikumspreis
- eine der beiden Verleihförderungen (die andere ging an Andreas Arnstedts DIE ENTBEHRLICHEN)
BIS AUFS BLUT, der „Zielgruppe“ wie „Fußvolk“ so prächtig gefiel, ist auch wirklich ein mitreißendes, fast brachiales Stück Kino. Dass bei einer der Vorführung die Bässe des Soundtracks die Lautsprecher im Saal beinahe ruinierten, wirkt weniger wie ein Vorführfehler als eine Art freud’scher Technik-Versprecher. Keine Frage, BIS AUFS BLUT hat Wumms, aber auch Herz. Zunächst kann man noch skeptisch sein, bei all der Coolness und Rasanz, angesichts von Pose und Gestus: Als Bub wird Tommy an der Bushaltestelle von älteren Kids dumm angemacht, worauf der gleichaltrige türke Sule rabiat eingreift – der Beginn einer langen, engen Freundschaft, dessen Entwicklung der Film im lauten Eiltempo zum Vorspann zeigt; wie beide in der Rapper-Szene aufwachsen, mit Gras-Deals Geld machen, ein dickes Auto fahren, ein lässiges Leben führen, einen Dreck auf Berufsschule (Sule) und Gymnasium (Tommy) geben; wie sich Tommy in Sina verliebt; er und Sule von einem Tuning-Laden träumen – und sich das Blatt wendet: Zivilbullen, Hausdurchsuchung. Tommy wandert in den Jugendknast, wo ihm das Leben zur Hölle gemacht wird.

Nach sechs Monaten ist er wieder draußen. „Opfer“ haben sie ihm auf den Handrücken tätowiert, und Tommy will nix mehr mit „der Scheiße“ zu tun haben, keine Drogen mehr, Sina zurückbekommen, Abschluss machen. Aber Sule ist und bleibt seine bester Freund, überhaupt das Milieu sein Zuhause, und hier kriegt der Film den Zuschauer, frisst einen mit Haut und Haaren. Ganz schnell vergessen ist aller Argwohn, entpuppen sich die Figuren, ihr Tun, Sein und Auftreten nicht als nervtötende Konstruktion, um Sozialdrama zu spielen, als hohl und selbstgefällig, um zu provozieren oder sich in seiner Wild- und Coolheit simpel selbst zu feiern. BIS AUFS BLUT erinnert an 13 SEMESTER, nicht nur, weil hier Würzburg zur Gangsta- und Rapper-Kleinstadt wird wie dort Darmstadt als perfekte Kulisse fürs kleine Studiumsuniversum; weil sich Großes auch im Kleinen besser betrachten lässt, vor allem die antreibende Verzweiflung und Verunsicherung dahinter. Auch BIS AUFS BLUT hantiert mit einigen Klischees und Typen, zeigt, dass und wie diese eben doch dem Leben entspringen – und vor allem: BIS AUFS BLUT ist ungeheuer witzig.

Regisseur Oliver Kienle lässt einen ebenso über die Protagoniste wie mit ihnen lachen, an ihren großen, bisweilen albernen Träumen und Selbstbehauptungen teilhaben und an dem dicken Mist, den sie bauen und angesichts dessen man trotzdem nicht anders kann, als sie zu mögen oder zumindest zu verstehen. Man schließt sie in Herz, alle. Sogar die Nebenfiguren, von denen keine einzige verkauft wird, ist rund und zugleich mit den nötigen Ecken versehen, sogar noch die Funktionalsten unter ihnen; Sules frühreife „Freundin“, die Zivilpolizistin oder der Lehrer, der dem Kindskopf Tommy am liebsten gleichzeitig Vernunft einbläuen und ihn umarmen würde, so aber einfach mit ihm Zigaretten raucht. Kienle schließt uns den Mikrokosmos von innen auf und plötzlich ist man in dieser vielfach abstoßenden Poserwelt aus „Ficken“-, „Fucker“- und „Fotzen“-Asozialität und -Großspurigkeit, in der es doch komplexer zugeht und heimeliger sein kann als im Vorstadthaus, wo die Mutter Therapeutin ist oder in der Landvilla, wo Tochter Weinprinzessin den rüden Straßentürken mitbringt, um – noch rüder – Papas Aufmerksamkeit zu bekommen. Mit ein Grund für all das Gelingen sind natürlich auch die beiden phantastischen Darsteller: Burak Yigit als Sule und Jacob Matschenz als Tommy, die jeder für sich die ganze große, darstellerisch doppelt schwierige Bandbreite von Hilflosigkeit und Humor, Brutalität, Angst und linkischer Liebe, von Aufrichtigkeit, Rollenspiel und Kontrollverlust meistert, die vielen Einzelaspekte ihrere Jungs so sicher und genau zusammenschnüren, dass man sich an ihnen kaum sattsehen mag.
Doch Kienle belässt es nicht bei dieser Rundreise. Er bietet uns unverschämt leichthändig und große emotionale Story um Freundschaft und Verrat, die ins Herz trifft. Tommy ist nämlich verpfiffen worden, will, immer mal wieder, herausbekommen von wem. Als Zuschauer, gewohnt, auf das größte dramatische Potential zu achten, denkt man sich schon, von wem. Aber auch, wenn es genauso ist, kommt es zugleich und am Ende ganz anders, in Sachen Stimmung, im Stil, in der Bedeutung. So lehrt einem BIS AUF BLUT in seiner bravourös ungestümen, lebensprallen Art, angesichts der man einige formale Spirenzchen wie das „Filmstreifenspulen“ nicht nur verzeiht, sondern gar begrüßt, einiges über Vernunft, Aufrichtigkeit und Loyalität, auf eine Art, wie das nur ganz sensibles und besonders nassforsches Kino kann. Beides bietet der laute und geschickte, rohe und elegante Starkstromfilm BIS AUFS BLUT, der es hoffentlich wirklich auf die Leinwand schaft.
Auch SCHWERKRAFT ist ein gute Film, dem der Max Ophüls Preis durchaus zusteht. Auch und gerade Fabian Hinrichs Spiel ist bemerkenswert. Doch: Drehbuchpreis? Na schön. Aber mit solch einer Begründung?
SCHWERKRAFT, das ist die Geschichte von Frederick (Hinrichs), der Kreditberater in einer Bank ist, jeden Morgen einen Parkplatz sucht und ihn sich wegschnappen lässt, der heimlich seine Ex-Freundin Nadine (v. WALDSTÄTTEN) beobachtet – und dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als sich vor seinen Augen ein Kunde aus Finanznöten erschießt. Das bringt den ordentlichen Mann natürlich aus der Bahn, wenn auch zunächst nur innerlich, und überhaupt: Ob da je was im Lot war, bestreitet der Film schließlich selbst. Als müsse er sich seine Lebendigkeit beweisen, lässt Frederick zunächst experimentell behutsam den Mr. Hyde raus, will eine CD im Laden klauen, einfach so, wird aber von einem Angestellten gewarnt: Vince (mit eingefrorenem Gesicht: Jürgen Vogel), Angestellter des Elektromarkts und Ex-Knacki war Fredericks alter Bandkollege, beide haben sich aus den Augen verloren. Und beide tun sie sich zusammen: Nachdem Frederick bei seinem Chef einsteigen will, dabei seine Kreditkarte verliert und auf Vincens Handwerkskunst angewiesen ist, starten sie eine Zweierkarriere und unterkühlte Freundschaft, in der Frederick Wissen und Daten seiner Kundschaft zur Handwerkskunst und den Unterweltkontakten von Vince beisteuert. Der Ex-Knacki bekommt seine erträumte Kneipe, Fredericks soziopathische Lebensenergie genug, um im Alltag aufzumucken und es mit Nadine neu zu versuchen. Doch das alles kann natürlich nicht gut gehen; Vince hat noch eine alte Rechnung zu begleichen und Frederick verliert immer mehr den Halt…

Wie in FIGHT CLUB dient in SCHWERKRAFT körperliche Gewalt und Normverletzung zur Selbstvergewisserung, Selbstverwirklichung, wird Verkrustetes aufgesprengt – und tatsächlich kauft man das Hinrichs Frederick sofort ab, das Überschreiten und den Wechsel von Spießer und Depp zum Brutalo und zugleich Verlorenen – die eine wie die andere Seite ist bereits angelegt oder wird ihm nicht ausgetrieben. Lakonisch und zugleich leicht traumwandlerisch ist die Inszenierung, ist die Gesetztheit der Worte und deren Fehlen, wenn es darum geht, was wirklich zählt und ist. Tatsächlich ist die Story geschickt, immer mehr rutscht Frederick hinein und zugleich hinaus, und dafür braucht es keinen eingebildeten Freund: Jürgen Vogels Vince ist kein jovialer Tyler Durden, im Gegenteil, er bleibt immer ein wenig unnahbar, selbst ein Verwundeter, und der Film birgt bei aller Skurrilität seine Tragik in Stimmung und Rhythmus immer schon in sich. Das ist – wie die MOP-Jury bemerkt – durchaus ganz großes Kino. Die letzten wenigen Einstellungen überraschen und brauchen dazu nur ein Lächeln, so dass man gerne drangibt, wie der Film schlussendlich etwas auseinanderfällt (was im Übrigen bei vielen Filmen des MOP-Langfilmwettbewerbes zu bemerken war).
Und natürlich ist da diese Szene, eine inhaltliche und bildliche Idee, wie man sie hierzulande kaum erwartet hätte: Vince willigt ein, Frederick zum Azubi zu nehmen; sie sitzen in einem Auto; in einer Gasse stehen einige kräftige Skinheads herum. Um gleich anzufangen mit der Lehre, ordnet Vince an, Frederick solle sich den Größten rauspicken. Vince reicht ihm einen Baseballschläger. Frederick überlegt kurz, nickt, steigt aus – und verhaut mit Ski-Maske und im edlen dunklen Bankeranzug samt Mantel ohne zu zögern die Kerle, die flugs reißausnehmen.
So bietet SCHWERKRAFT tatsächlich Momente, die, so die MOP-Jury, an die Filme der Coen-Brüder erinnern, schräg und schwarz und irgendwie unauflöslich, die unterhalten und zugleich einen leicht irritiert zurücklassen.

Auch die Drehbuchjury (Daniel Blum, Anette Kührmeyer, Jan Henrik Stahlberg) hat also durchaus ein bisschen Recht, doch zugleich hat dieser wirklich vorzügliche Film einige Mängel, die sich nicht mit dem angeführten geschickten Unterlaufen von „konventionellen“ Genrekino-Erwartungen wegloben lassen, z.B. wenn Vince Freundin, die zentral wird für seine Backstory-Wunde, irgendwie plötzlich da ist; wenn für das dramatische Ende schnell noch erklärend die Ex-Arbeitskollegin von der Arbeit als Tippgeber eingeblendet wird, hinsichtlich der sich SCHWERKRAFT dramaturgisch auch nicht entscheiden will.
Genreerwartungen unterlaufen kann zwischen NO COUNTRY FOR OLD MAN und DER KNOCHENMANN (um mal zwei schwere Geschütze aufzufahren) manchmal eben auch bedeuten, unsauber zu erzählen. Hier bedeutet es vor allem, zwischen Erfüllen und Verweigern sehr oft, aber nicht immer die richtige Balance und vor allem: die richtige Konsequenz zu finden. Das Ausbrechen aus sterilen Leben als Story muss sich zudem gerade erzählerisch – siehe FIGHT CLUB, siehe AMERICAN BEAUTY, auch in Deutschland: siehe Ulrich Köhlers MONTAG KOMMEN DIE FENSTER – an ganz anderen Standards der Originalität (und damit auch der „Genrehaftigkeit“) messen lassen.
Mehr aber ist das Lob der Jury selbst überzogen. „Restlos“ gelungen sei der Film; die Entscheidung, so verkündet Stahlberg auf der Bühne, sei sehr leicht gefallen. Was den Film ebenso ungerechtfertigt überhöht wie er alle anderen – z.B. MEIN LEBEN IM OFF – herabsetzt. Auch wenn Stahlberg Erlenwein Kontra gab, weil dieser in seiner Dankesrede annahm, die Jury habe nur den Film gesehen und nicht das Skript gelesen: SCHWERKRAFT, der seine drehbuchjurygelobte „enorme Leichtigkeit“ zum großen Teil den Schauspielern und der Inszenierung verdankt, wurde wohl eher als Ganzes ausgezeichnet als sein Skript allein.
Übrigens, der letzte Film, der dem Max Ophüls Preis und den Drehbuchpreis erhielt, war 2006 Benjamin Heisenbergs SCHLÄFER. Auf solche eine Qualität wartet man heute noch und wieder. Denn im Guten wie im Schlechten war der 31. Max Ophüls Preis kein Festival der Drehbücher.

Die Preisträger im Überblick:
MAX OPHÜLS PREIS 2010:
SCHWERKRAFT, Regie: Maximilian Erlenwein
Verleihförderung von je 9.000 Euro geht zu gleichen Teilen an:
BIS AUF´S BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG, Regie: Oliver Kienle
DIE ENTBEHRLICHEN, Regie: Andreas Arnstedt
Preis des saarländischen Ministerpräsidenten:
PICCO, Regie: Philip Koch
Der Preis für den Besten Kurzfilm:
SCHONZEIT, Regie: Irene Ledermann
Der SR/ZDF-Drehbuchpreis:
SCHWERKRAFT, Regie: Maximilian Erlenwein
Der Förderpreis der DEFA-Stiftung:
LOURDES, Regie: Jessica Hausner
Der Preis für den Besten Dokumentarfilm geht zu gleichen Teilen an:
NIRGENDWO.KOSOVO, Regie: Silvana Santamaria
MY GLOBE IS BROKEN IN RWANDA, Regie: Katharina von Schroeder
Der Preis für den Mittellangen Film: RAMMBOCK, Regie: Marvin Kren ((= Gewinner des letztjährigen Kurzfilmpreises für SCHAUTAG)
Sonderpreis für FABIAN HINRICHS für seine Rolle in „Schwerkraft”
Der Preis für die Beste Nachwuchsdarstellerin: NORA VON WALDSTÄTTEN
Der Preis für den Besten Nachwuchsdarsteller: SEBASTIAN URZENDOWSKY
Der Filmmusikpreis: ACADEMIA PLATONOS – PLATO’S ACADEMY, Regie: Filippos Tsitos
Der Publikumspreis: BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG, Regie: Oliver Kienle
Der Preis der Schülerjury: BIS AUFS BLUT – BRÜDER AUF BEWÄHRUNG, Regie: Oliver Kienle
Der Interfilmpreis: SUICIDE CLUB, Regie: Olaf Saumer
Bernd Zywietz
Hier geht's zum ersten Teil unserer Max Ophüls Preis-Berichterstattung!